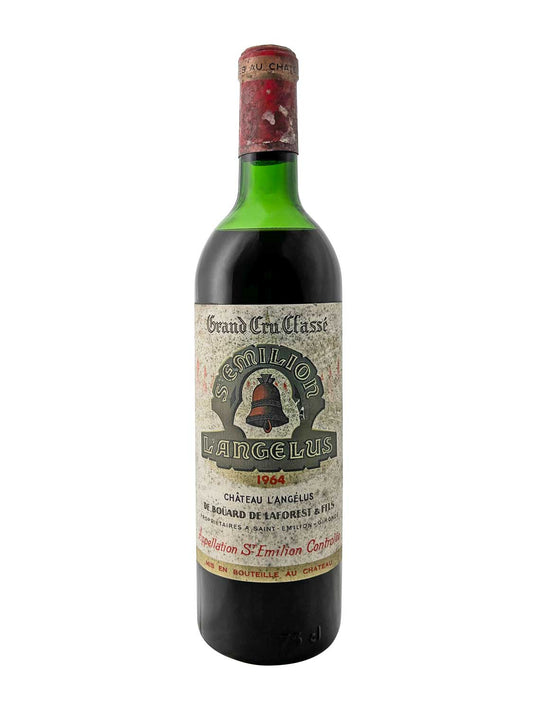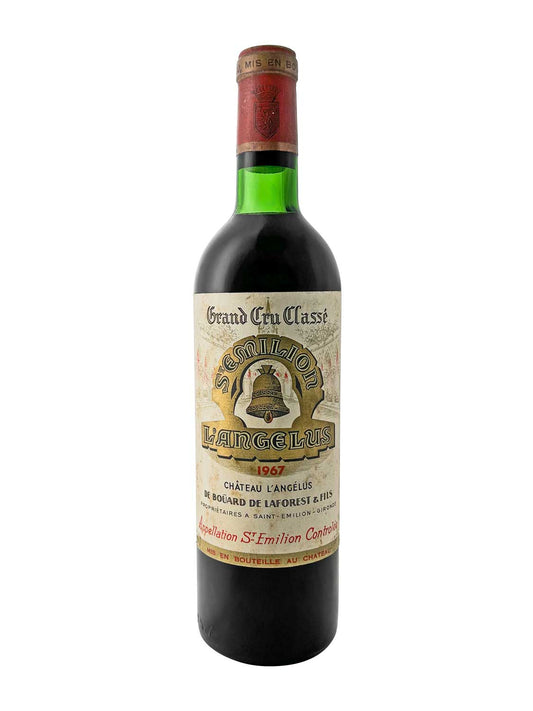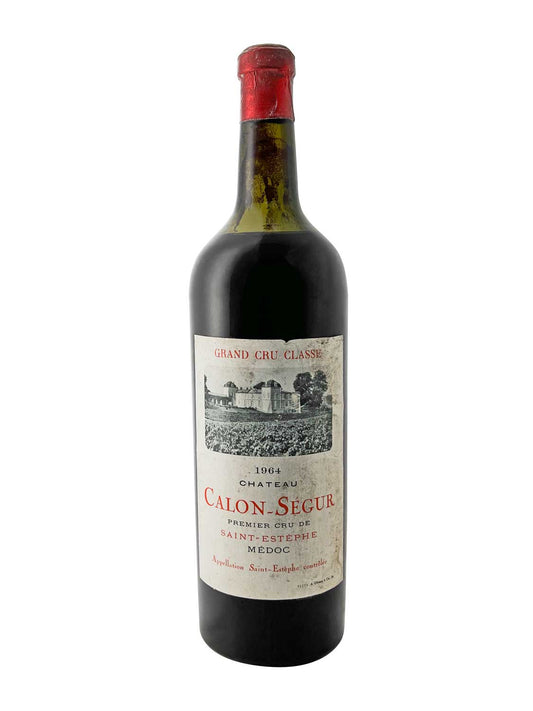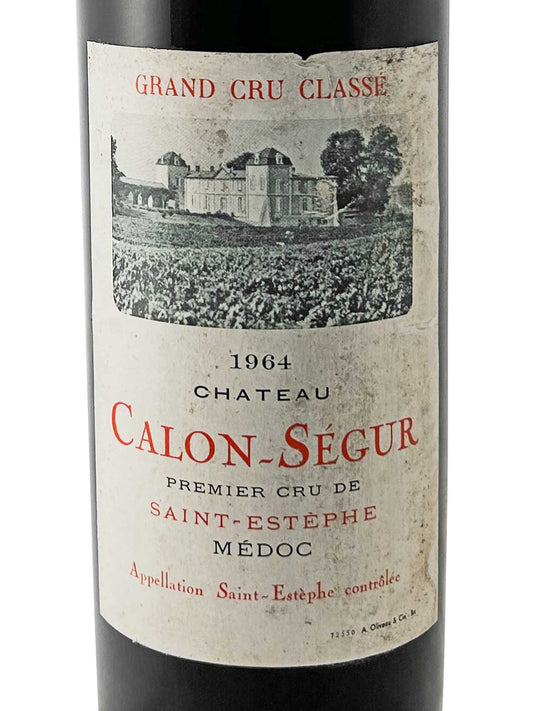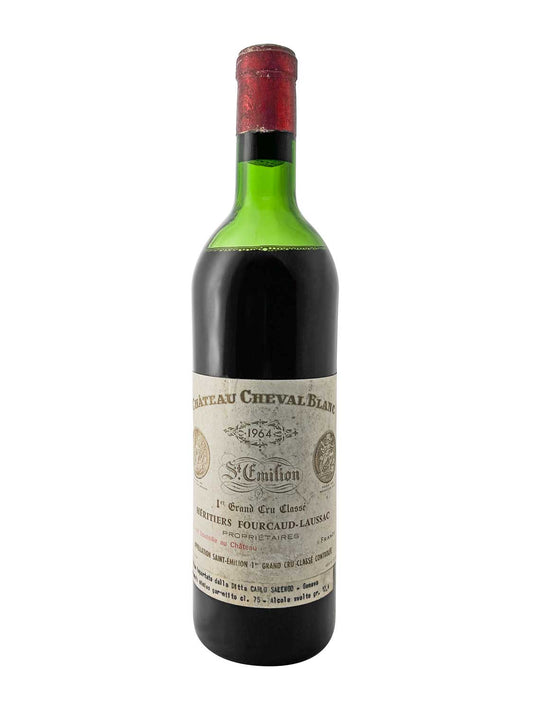Veganer Wein – Doch nur ein cleveres Verkaufsargument?
Warum das Label oft mehr Schein als Sein ist
In den letzten Jahren hat sich der Trend zu veganen Produkten rasant verbreitet. Besonders in der Weinbranche wächst die Nachfrage nach veganem Wein, der ohne tierische Hilfsmittel hergestellt werden und somit als „tierfrei“ gelten soll. Doch hinter dem Begriff „veganer Wein“ verbirgt sich nicht nur ein alternativer Herstellungsprozess, sondern auch eine ausgeklügelte Marketingstrategie. In diesem Blog-Beitrag betrachten wir kritisch, warum veganer Wein zunehmend als Marketinginstrument genutzt wird, welche Beweggründe dahinterstehen und wie Weinsammler die vermeintliche Tierfreiheit kritisch hinterfragen sollten.
1. Was bedeutet „veganer Wein“?
Bevor wir auf die Marketingaspekte eingehen, ist es wichtig zu verstehen, was „veganer Wein“ eigentlich bedeutet. Der Begriff beschreibt Wein, bei dessen Herstellung keine tierischen Produkte verwendet werden. Das betrifft vor allem die Klärung (auch Filtration genannt), bei der traditionell tierische Substanzen wie Gelatine, Kasein (Milchprotein) oder Eiweiß eingesetzt werden, um Trübstoffe zu entfernen und den Wein klar erscheinen zu lassen.
Veganer Wein verzichtet auf diese tierischen Hilfsmittel und nutzt stattdessen pflanzliche oder mineralische Alternativen wie Bentonit (Tonerde), Kieselgur oder pflanzliche Proteine. Ziel ist es, ein Produkt anzubieten, das frei von Tierprodukten ist und somit für Veganer und ethisch bewusste Weinsammler attraktiv erscheint.
2. Warum ist das Thema so populär?

Der vegane Lebensstil gewinnt weltweit immer mehr Anhänger. Menschen entscheiden sich aus ethischen, ökologischen oder gesundheitlichen Gründen gegen Tierprodukte. Für diese Zielgruppe ist es naheliegend, auch beim Wein auf eine tierfreie Produktion zu achten.
Zudem wird veganer Wein oft als nachhaltiger und moderner beworben. Die Kennzeichnung „vegan“ kann für Winzer ein Alleinstellungsmerkmal sein und hilft dabei, sich im umkämpften Markt abzuheben. Gerade in einer Zeit, in der Konsumenten immer bewusster einkaufen, spielt das Label eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung.
3. Vegan als Marketing-Tool: Warum das Label oft mehr Schein als Sein ist
Hier liegt der Kern des Problems: Viele Experten und Weinsammler fragen sich, ob vegane Weine wirklich eine ethische Alternative darstellen oder nur ein cleveres Marketinginstrument sind. Denn immerhin lässt sich in einem Wein nicht eindeutig nachweisen, ob bei der Filtration tierische oder pflanzliche Hilfemittel verwendet wurden. Auch geschmacklich macht es keinen spürbaren Unterschied, ob man einen normalen oder veganen Wein trinkt.
Lesen Sie auch: Terroir – Die Seele von Bordeaux-Wein
a) Das Prinzip der freiwilligen Kennzeichnung

In Deutschland und Europa gibt es keine verbindlichen gesetzlichen Vorgaben für die Bezeichnung „vegan“. Das bedeutet:
- Freiwilligkeit: Winzer können selbst entscheiden, ob sie ihre Weine als vegan deklarieren.
- Keine verpflichtende Kontrolle: Es gibt keine zentrale Zertifizierungsstelle für veganen Wein; Zertifikate wie „Vegan Society“ sind freiwillig.
- Fehlende Transparenz: Viele Hersteller verwenden das Label ohne klare Nachweise oder unabhängige Kontrolle.
Das führt dazu: Das Wort „vegan“ wird häufig zum reinen Verkaufsargument – unabhängig davon, ob im Herstellungsprozess tatsächlich alle tierischen Hilfsmittel vermieden wurden.
b) Marketingstrategien hinter dem Label
Viele Winzer nutzen das vegane Label gezielt aus:
- Positionierung im Premium-Segment: Vegane Produkte werden oft mit einem modernen, verantwortungsbewussten Image verbunden.
- Abgrenzung vom Wettbewerb: Das Label hebt das Produkt hervor und spricht gezielt eine bestimmte Zielgruppe an.
- Storytelling & Markenbildung: Durch die Betonung von Nachhaltigkeit und Ethik schaffen Hersteller emotionale Bindungen zum Kunden.
- Preispolitik: Vegane Weine werden häufig teurer verkauft – das Image eines hochwertigen Produkts rechtfertigt höhere Preise.

c) Die Illusion der Tierfreiheit
Das Label „vegan“ suggeriert oft eine vollständige Tierfreiheit im Herstellungsprozess. Doch in Wirklichkeit:
- Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung zur genauen Deklaration aller verwendeten Stoffe.
- Manche Weine tragen zwar das Label „vegan“, wurden aber auf traditionelle Weise hergestellt.
- Die tatsächliche Transparenz bleibt oftmals auf der Strecke, da bei der Filtration mit tierischen oder pflanzlichen Hilfsmittel diese nicht nachweisbar sind.
Damit wird das vegane Label zum effektiven Marketinginstrument – es schafft Vertrauen und Differenzierung beim Verbraucher, obwohl die tatsächliche Herstellung manchmal weniger transparent ist.
4. Warum viele Winzer das vegane Label bewusst einsetzen
Viele Produzenten sehen im veganen Trend eine Chance:
- Neue Zielgruppen erschließen: Veganer, Vegetarier sowie umweltbewusste Konsumenten zählen zu den wichtigsten Zielgruppen.
- Imagepflege: Ein nachhaltiges Image wirkt positiv auf die Markenwahrnehmung.
- Wettbewerbsvorteil: In einem hart umkämpften Markt kann das vegane Label den entscheidenden Unterschied machen.
- Innovationsdruck nutzen: Mit veganen Produkten positionieren sich Winzer modern und zukunftsorientiert.
Diese Strategien sind nicht grundsätzlich negativ – doch sie werfen Fragen auf: Ist der Fokus auf Veganismus wirklich ehrlich gemeint oder nur ein cleveres Verkaufsargument?
Lesen Sie auch: 8 Vorteile von Weinflaschen aus Glas
5. Kritische Stimmen: Ist veganer Wein nur ein Trick?

Viele Branchenbeobachter kritisieren:
- Mangelnde Regulierung: Ohne gesetzliche Standards kann jeder Winzer seine Produkte beliebig als „vegan“ deklarieren.
- Verzerrte Wahrnehmung: Verbraucher könnten glauben, dass alle veganen Weine automatisch ethisch unbedenklich sind – was nicht immer stimmt.
- Marketing statt Überzeugung: Für manche Hersteller ist das vegane Label eher ein Trendbegriff denn Ausdruck einer tief verwurzelten Überzeugung.
Zudem besteht die Gefahr, dass durch den Fokus auf Veganismus andere wichtige Aspekte wie Umweltverträglichkeit oder soziale Verantwortung vernachlässigt werden.
6. Was bedeutet das für Weinsammler?
Wer beim Kauf von veganem Wein ausschließlich auf das Label vertraut, läuft Gefahr:
- Wein zu kaufen, der nur minimal vegan ist oder nur mit dem Etikett werben.
- Nicht genau zu wissen, was im Herstellungsprozess passiert ist.
Daher empfiehlt es sich:
- Beim Händler nach detaillierten Informationen zu fragen.
- Sich bewusst zu machen: Das vegane Label allein garantiert nicht automatisch einen ethisch perfekten oder nachhaltigen Wein.
Lesen Sie auch: Wein vom Weingut oder im Weinhandel kaufen?
Fazit: Vegan als Marketingstrategie – ja oder nein?
Der Trend zum veganen Wein zeigt deutlich: Das Label ist für viele Hersteller vor allem ein mächtiges Marketinginstrument. Es ermöglicht ihnen,
- sich im Markt abzugrenzen
- neue Kundengruppen anzusprechen
- ein modernes Image aufzubauen
Gleichzeitig gibt es aber auch echte Bemühungen von Winzern, nachhaltige und tierfreie Herstellungsprozesse umzusetzen.
Für Weinsammler gilt: Kritisch bleiben! Das vegane Label sollte nie allein Entscheidungskriterium sein. Stattdessen lohnt es sich, direkt beim Hersteller nachzufragen und bewusst einzukaufen.
Denn letztlich entscheidet nicht nur das Etikett über die Qualität eines Weins – sondern auch über Transparenz und Glaubwürdigkeit des Winzers.